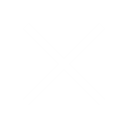Diversity – als Begriff schon oft gehört, irgendwie schon länger im Bewusstsein und von der Haltung her sind wir eh alle divers, schon immer gewesen. Aber die anderen müssten mal für sich schauen – denkt Mann/Frau einfach mal so.
Ich? Ich lerne gerade, dass es sich lohnt genauer hinzuschauen.
Ich erinnere mich, dass ich in der Grundschule der 3.-ten und 4.-ten Klasse einen Mitschüler aus Italien, nein, mit den Wurzeln seiner Herkunft in Italien, hatten. Mario. Mario war in meiner Erinnerung schon toll, lustig, er gehörte dazu und doch war er auch ein stückweit immer am Rand. Er kam halt aus Italien und das war 1972/1973 unvorstellbar weit weg. Derjenige, der allerdings tatsächlich ein bisschen mehr gemobbt wurde, war aber nicht Mario, sondern ich, weil ich zum 3.-ten Schuljahr aus Berlin kommend nun in Köln zur Schule ging und alle anderen waren ja seit zwei Jahren bereits eine „Gemeinschaft“. Mario war also anders, zwar in der Klassengemeinschaft aber eben „von weit weg her“ und ich als Berliner Schnauze sofort als ebenfalls anders erkennbar.
Jeder von uns beiden hat sich im Laufe der Zeit mit anderen, einzelnen aus der Klasse angefreundet, heute würde man sagen, wir haben Networking betrieben und Beziehungen aufgebaut. Wir haben Sub-Milieus begründet und unsere Zugehörigkeit zu einem Teil der Klasse darüber definiert.
Der erste Schritt die Begrenzung von Vielfalt aufzuheben, ist ja sich besser, vertiefter kennenzulernen. In der Folge geht es dann um die „Beweise“, sich aufeinander verlassen zu können und glaubwürdig – ehrlich miteinander zu sein. Der Eigennutz in dieser Vertrauensformel war für uns beide und unsere jeweiligen Freunde in der Klasse der gleiche: wir wollten alle wenigstens in einem Teil der Klasse zugehörig sein und haben dies hauptsächlich über gleiche Interessen und Hobbies, also Ähnlichkeiten, spielerisch hergestellt – und das, was am anderen jeweils anders war, war dann nicht mehr so wichtig, war dann nicht das bestimmende Merkmal im Vordergrund.
Diversity steht heute für mich mehr denn je als persönliche Herausforderung neben den tiefen menschlichen Bedürfnissen von Zugehörigkeit, von Gemeinschaft, von Beziehungen und Milieus – alles Dinge, die Vielfalt definitorisch nicht zwingend mit beinhalten.
Ich lerne gerade, dass es sich besser vielfältig leben lässt, wenn man nicht mehr nur nach Gemeinsamkeiten sucht, sondern vielmehr neugierig ist auf die Unterschiede: Wie ist jemand von woanders denn z. B. aufgewachsen, wie hat er/ sie Kindheit, Familie, Schule, Freundschaften etc. erlebt? Wenn ich mir vorstelle, dass sich zwei darüber unterhalten, wird das ein ziemlich spannendes und lehrreiches Gespräch für beide – Neugier, gut Zuhören und sich einlassen wollen vorausgesetzt.
Eigentlich passiert etwas, was wir an unseren Lieblings-Urlaubsorten oder allgemein auf Reisen so schätzen, wenn wir mit Einheimischen in Austausch kommen und etwas über das Alltagsleben an unserem Urlaubsort erfahren. Es entsteht eine Verbundenheit mit dem Ort, wo wir so etwas erleben konnten; Diversity im Urlaub geht also (leichter). Wir lernen, wie andere leben, denken, handeln etc. Wir lernen fast automatisch, darüber zu reflektieren, bauen Vorurteile ab, hinterfragen unsere Vorannahmen, werden aufmerksam für Unterschiede (und natürlich auch Gemeinsamkeiten) und können sie gut aushalten, sie gut akzeptieren und annehmen.
Ich arbeite seit vielen Jahren als Organisationsberater, Coach und Personalentwickler mit unterschiedlichen „Kunden“ aus dem öffentlichen Dienst, aus Wirtschaftsunternehmen und aus Non-Profit-Organisationen zusammen. Ich lerne also viele unterschiedliche Menschen durch meine Arbeit kennen, Persönlichkeiten unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft und Nationalität, vielfältige Weltanschauungen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Arbeitsinhalte, Ausbildungen, Stellung und Funktion in der Hierarchie der Organisation etc. Wenn so eine Gruppe zu einem Workshop zusammenkommt, ist Vielfalt Programm. Ich bin verantwortlich dafür, dass in der konzentrierten Form von Zusammenarbeit, die im Workshop gegeben ist, die Ziele erreicht werden, bin verantwortlich für einen Rahmen, der diese enge und konzentrierte Form der Zusammenarbeit und Ergebniserreichung ermöglicht. Und die Teilnehmenden und ich gehen die gleichen Schritte miteinander, um
- Vertrauen aufzubauen, indem wir uns ein stückweit anders und neu kennenlernen,
- uns auf Gegenseitigkeit als verlässlich und ehrlich miteinander zu erleben,
- gemeinsam das oder die Ziele zu erreichen, die wir vereinbart haben.
Solche Formen von Kollaboration werden von den allermeisten als bereichernd erlebt, zumindest können selbst kritische Geister wieder für eine Zeitlang ihren Frieden mit ihrer Organisation/ Abteilung schließen. Ich fange an, auch privat genauer hinzuschauen und die Elemente von Diversity für mich (und andere) bewusster zu nutzen: mich nicht mehr nur im Spannungsfeld von Sympathie und Antipathie, von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu bewegen, sondern wieder mehr Neugierde und Offenheit auf meiner Seite zuzulassen.